Ende der Seilschaften
Wenn alle im Vorstand Männer um die 50 sind, denken alle gleich und machen die gleichen Fehler. Sich breiter aufzustellen, kann einen erfolgreicher machen – und vor Krisen bewahren.
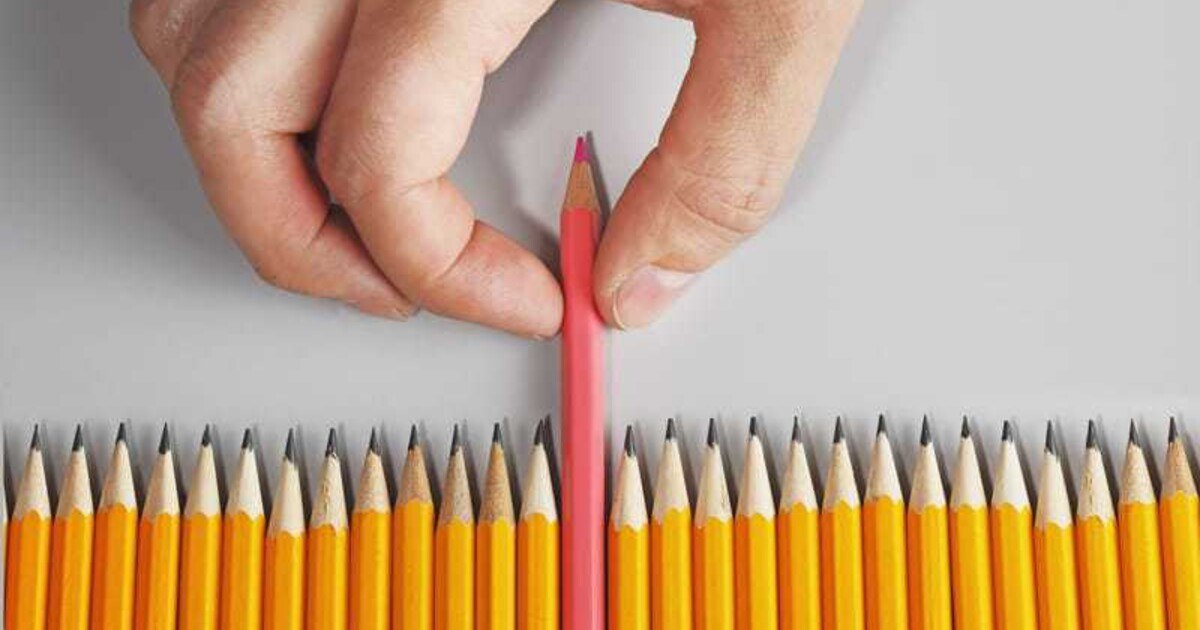

Diversity im Vorstand? Dazu wollen die Geschäftsführer kein Interview geben, sagt die Pressesprecherin. Weil, nun ja, um die Wahrheit zu sagen, die Herren schwämmen alle auf einer Linie. Die einzige Frau in höherer Ebene sei die Personalchefin, und die gehöre nicht dem Vorstand an. Daher: Leider kein Kommentar zu diesem Thema. Das ist kein Einzelfall. Um es klarzustellen: Wir reden hier nicht von ATX-Unternehmen. Die sind gesetzlich etwa zu Frauenquoten in der höchsten Ebene verpflichtet und hinter vorgehaltener Hand: Sie tun sich nicht immer leicht damit. Nein, es geht um Unternehmen, die über sich hinausgewachsen sind und den Sprung zum Weltmarktführer geschafft haben. Wozu, fragt ein solcher Firmenchef, soll ich mich um „Minderheitenprogramme“ kümmern? Da kümmere ich mich lieber um meinen Umsatz.
Da läuft etwas schief, seufzt Manfred Wondrak, Chef von factor-D Diversity Consulting. Er hilft Unternehmen, noch besser zu werden, indem sie sich breiter aufstellen. Was gern als Randgruppen abgetan werden – Frauen, Ältere, LGBT (lesbian, gay, bi, transgender), Menschen anderer Herkunft, Religion oder mit Behinderung –, das sind für ihn keine Minderheiten, sondern die Mehrheit. Bloß in der Vorstandsebene findet man sie selten. Aber, so seine Argumentation, wenn ein Unternehmen breit aufgestellt ist, ist es auch robust. Dafür nennt er drei Gründe.
1. Je mehr Ideen, desto überlebensfähiger
Nach der Finanzkrise fragte sich der Internationale Währungsfonds IWF, wieso man diese nicht habe kommen sehen. Seine späte Erkenntnis: Weil die Entscheidungsgremien durchwegs homogen besetzt waren. Fast nur Männer, alle gleich alt, gleicher Bildungshintergrund, aus gleichen Wirtschaftssystemen stammend. Daher unterliefen ihnen auch die gleichen Fehler, bei denen sie sich auch noch gegenseitig bestärkten. Hätten wir Andersdenkende zu Wort kommen lassen, so die Conclusio des IWF, hätten wir uns die Krise erspart.
Für Unternehmen bedeutet das: Es geht nicht um Randgruppenförderung oder um good citizenship. Sondern darum, viele Zugänge zu jedem Thema zu finden, kreativer zu sein, innovativer und, im Krisenfall, überlebensfähiger. Weil unterschiedliche Köpfe unterschiedliche Ideen kreißen. Wondrak verweist auf mehrere Metastudien, die den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen, die heterogen aufgestellt sind, mit denen vergleichen, die homogen gestrickt sind. Über die große Zahl gewinnen die heterogenen haushoch. Was natürlich nichts über den Einzelfall aussagt.
2. Mehr vom Gleichen macht betriebsblind
Ein Beispiel: Nach der Arbeit geht ein Vorstand gerne mit seinen Kollegen auf ein Bier. Frauen würden sich da allerdings nicht so recht wohlfühlen. Darüber hinaus müssten sie ohnedies heim zu ihren Kindern. Mit diesem Gedankengang folgt er einem zutiefst menschlichen Grundprinzip: Er sucht sich seine Kollegen – bewusst oder unbewusst – nach Ähnlichkeit zu ihm selbst aus. Die meisten Personalchefs haben inzwischen verstanden, dass ein solcher Einheitsbrei gefährlich ist. Doch damit stehen sie nicht selten auf verlorenem Posten. Dasselbe Problem quält sie auch eine Ebene tiefer.
Dort formulieren die Chefs der Fachabteilungen Stellenbeschreibungen, die wie Klone ihrer selbst wirken. Da können HR und Personalberater noch so oft Quereinsteiger und „bunte“ Kandidaten vorschlagen, die Endauswahl treffen die Fachabteilungen. Und alles bleibt beim Alten.
Weg mit den Männervereinen
Die Lösung liegt im Rekrutieren nach Kompetenz, nicht nach Ähnlichkeit zum Vorhandenen. Hier lässt sich bei den Symphonieorchestern abkupfern. Sie waren früher reine Männervereine, die argumentierten, dass Frauen dem harten Job physisch nicht gewachsen wären. Dann gingen sie dazu über, Bewerber hinter einem Vorhang sitzend vorspielen zu lassen. Siehe da: In kürzester Zeit explodierte der Frauenanteil von fünf auf 37 Prozent. Aus diesen Erfahrungen entwickelte die Schweizer Harvard-Professorin Iris Bohnet ein unbestechliches Recruitingkonzept für Unternehmen. Erst sucht der Computer die eingehenden Lebensläufe nach Kompetenzen ab, dann müssen die Bewerber online lebensnahe Geschäftsfälle knacken, und zuletzt werden sie – ohne dass der Recruiter Lebenslauf oder Ergebnisse kennt – nach einem Fragebogen zu Meinungen und Einstellungen interviewt. Hier darf der Recruiter auch einen subjektiven Sympathiepunkt vergeben. Erst im letzten Schritt fließen alle Ergebnisse zusammen. Der beste Kandidat ist der mit der höchsten Punktesumme – auch wenn er oder sie dunkle Haut hat, im Rollstuhl sitzt oder schwul ist.
3. Fragen Sie: Was bringt uns das?
Wer feststellt, „dass wir eine Frau im Vorstand brauchen, der hat schon verloren. Die Arme wird immer die Quotenfrau bleiben, ihr Aufstieg nie auf ihre Leistung zurückgeführt. Tatsächlich werfen viele solcherart zum Handkuss Gekommene oft bald das Handtuch: Weil sie sich in den Old-Boy-Klüngeln nicht behaupten können.
Der richtige Ansatz läuft umgekehrt, sagt Wondrak: „Fragen Sie: Was bringt es uns, eine Frau in den Vorstand zu holen?“ Die Damen werden dann über den Nutzen rekrutiert, den sich der Vorstand von ihrer weiblichen Sichtweise erwartet. Ist er wirklich konsequent, scheut er sich auch nicht, gleich mehreren Frauen die Tür zu öffnen, damit er ihnen mehr Gewicht verleiht. Selbstredend müssen die Herren ihnen dann auch ihre Netzwerke öffnen.



