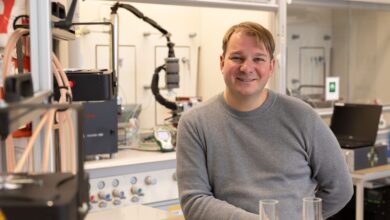Zelte statt Paläste bauen
„Von den Kunden erfährt man nicht, was das nächste große Ding ist“, meint Nikolaus Kawka, CEO von Zühlke Engineering in Österreich. Er hilft Unternehmen dabei, Businessinnovationen auf Schiene zu bringen. Doch oft werden die zarten Pflänzchen regelrecht erdrückt. Schuld sind überzogene Erwartungen. Ein Gespräch über neue Geschäftsmodelle, die Bedeutung von Agilität und klassische Stolpersteine.

INTERVIEW STEPHAN STRZYZOWSKI
In sehr vielen Unternehmen steigt aktuell der Druck, zu innovieren. Woran liegt das? Es gibt mehrere Treiber. Computersysteme werden etwa immer leistungsfähiger und auch die Verfügbarkeit von Daten nimmt zu. Darüber hinaus wird es leichter, innovative Geschäftsmodelle zu schaffen, indem man bestehende Elemente rekombiniert.
Haben Sie dafür ein Beispiel? Denken wir an das Geschäftsmodelle von Gillette. Sie schenken die Rasierer her und verkaufen dafür die Klingen sehr teuer. Ähnlich macht es Nestlé mit Nespresso. Die Maschinen sind vergleichsweise günstig, die Kapseln nicht. Dieses vergleichsweise alte Geschäftsmodell taucht jetzt überall auf.
Viele Unternehmen suchen nach großen Disruptionen und nennen Beispiele wie Uber oder Airbnb. Übersehen sie dadurch vielleicht das Potenzial kleiner Innovationen? Natürlich kann nicht jeder eine ganze Branche umkrempeln. Viele Betriebe haben aber Produkte im Feld, die sie jetzt digital anreichern können. Ein Beispiel sind Glühbirnen. Die kann ein Hersteller so erweitern, dass sie mit Bewegungsmeldern und einer Anbindung ans Internet als Alarmanlage funktionieren. Unternehmen sollten also nicht ihr Kerngebiet verlassen und versuchen, Uber zu werden. Sie müssen vielmehr herausfinden, wie sie ihr bestehendes Geschäftsmodell durch digitale Möglichkeiten erweitern können. Dann können die klassische und die digitale Welt perfekt koexistieren.
Um solche Innovationen umzusetzen, braucht es Kultur, Raum, Ressourcen und Zeit. Oft Mangelware, wenn Unternehmen bereits merken, dass sie dringend neue Produkte brauchen. Liegt darin der Knackpunkt? Timing und Ressourcen sind bestimmt ein Problem. Oft kommt darüber hinaus aber noch ein kritischer Punkt dazu: Die neuen digitalen Services werden häufig an den klassischen Erlösmodellen gemessen. Der Return on Invest kann aber stark abweichen. Wenn man das übersieht, läuft man Gefahr, die neuen Pflänzchen mit überzogenen Gewinnerwartungen zu erdrücken. Ein Faktor sind natürlich auch die Talente, die man finden und binden muss, und es braucht das Topmanagement, das einen entsprechenden Changeprozess begleitet. Mein Rat: Es macht Sinn, sich immer nur auf eine einzige Innovation zu konzentrieren. Und: Man muss das Neue vor dem Klassischen schützen.
Wieso das? Weil das neue digitale Geschäftsmodell oft das klassische kannibalisiert. Oder das digitale wirft nicht die Margen ab, die man vom klassischen erwarten würde.
„Man muss das Neue vor dem Klassischen schützen.“
Wie schwierig ist es denn, die Mitarbeiter für solche Veränderungsprozesse zu begeistern? Daran muss man gezielt arbeiten, um das „Not invented here“-Syndrom zu verhindern. Oft fällt es nämlich besonders schwer zu akzeptieren, dass einen Innovationen überrollen, die aus völlig anderen Branchen hereinschwappen. Das ist ein großer Killer. Wir nehmen auch wahr, dass viele Innovationsprojekte mit zu geringem Budget ausgestattet sind. Das demotiviert und lässt sie auf halbem Weg absaufen. Hier nach dem Motto: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“, zu agieren, ist ein großer Fehler.
Oft suchen Unternehmen ihr Heil in Kooperationen mit Start-ups. Ist das Ihrer Erfahrung nach erfolgversprechend? Mein Eindruck ist, dass teilweise Feigenblattpolitik betrieben wird. Man versucht, den Problemen innerhalb der Organisation zu entgehen, indem man sich aus kurzfristigen Start-up- Initiativen wesentliche Impulse erwartet. Doch auch dort ist es eine Frage der Risiko- und Budgetgewichtung. Man kann zwar für relativ wenig Geld mit Start-ups kooperieren, hat aber ein großes Risiko, dass es scheitert. Wenn man selbst ein internes Projekt mit professioneller Unterstützung startet, sind die Investments in der Regel höher, dafür steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass etwas herauskommt.
„Wir müssen die Art, wie wir Wissen organisieren und produzieren, neu aufstellen.“
Was macht den Unterschied? Es ist wichtig, die Geschäftsmodelle frühzeitig zu diskutieren und die technische Machbarkeit frühzeitig abzuklopfen. Auch der Blick auf die Perspektive des Endkunden ist von Anfang an nötig.
Tatsache ist, dass die Produktlebenszyklen immer kürzer werden, sich der Markt und die Kundenbedürfnisse schneller ändern. Müssen sich Unternehmen damit abfinden, in einen permanenten Selbsterneuerungsprozess zu geraten? Definitiv. Die nächste Produktgeneration kannibalisiert mittlerweile fast immer die bestehende. Niemand kann es sich mehr leisten, den Produktlebenszyklus bis zum Ende durchlaufen zu lassen. Eigentlich muss schon am Peak ein neues Produkt parat stehen. Das müssen jetzt auch die etablierten Betriebe lernen.
Muss man zwangsweise eine agile Organisation werden, um gelebte Innovation im Unternehmen zu verankern? Ja, ich bin sehr sicher, dass es das braucht. Dafür gibt es diverse Gründe. Die jungen digitalen Talente sprechen nicht mehr auf direktiven Führungsstil an. Wissensarbeiter brauchen andere Modelle der Koordination und der Zusammenarbeit. Agilität ist auch so wichtig, weil eine auf Jahre vorauseilende Unternehmensplanung nicht mehr funktioniert. Betriebe müssen agil und rasch agieren können. Wir müssen Zelte statt Paläste bauen. Es braucht kleine Initiativen. Wir müssen die Art, wie wir Wissen organisieren und produzieren, neu aufstellen.
Braucht es „Spinner“ und digitale Hofnarren für das Thema? Wir haben einmal in einem Maschinenbauunternehmen eine Designthinking-Session mit Ingenieuren gemacht und waren erstaunt, wie sie die Bude gerockt haben. Der digitale Hofnarr ist ein möglicher Ansatz, aber oft können Menschen, denen das nicht auf der Stirn steht, im richtigen Umfeld total gut „out of the box“ denken. 99 Prozent der Ideen sind ja schon im Unternehmen, man muss sie nur aus der Organisation herauskitzeln.
China und die USA lassen Europa in vielen Bereichen hinter sich. Müssten heimische Unternehmen den internationalen Mitbewerb stärker im Auge behalten? Die europäische Industrie tut sich schwer, weil sie sich immer fragt, ob dieses oder jenes erlaubt ist, ob es einen Standard gibt, und zu lange wartet. In der gleichen Zeit haben Unternehmen aus China schon Fakten geschaffen. Risikoaverses Denken und eine schlechte Fehlerkultur sind eine echte Gefahr für viele Betriebe.
Wo beobachten Sie noch typische Innovationskiller in Unternehmen? Vielfach glauben die Zuständigen, den konkreten Usecase schon vorher zu kennen, und setzen ohne Markttest ein fertiges Produkt in den Markt. Und dann gibt es Überraschungen, wenn die User den Service nicht oder anders verwenden oder nicht dafür zahlen. Innovation muss man vielmehr als zyklischen Prozess verstehen. Man macht einen Plan, erprobt, revidiert, schafft ein neues System, geht wieder in den Markt und nähert sich dem idealen Geschäftsmodell an.
Wissen die Kunden aber wirklich immer, was sie wollen? Kundenbefragungen können Unternehmen ja auch fatal in die Irre führen. Das stimmt. Dazu gibt es ein berühmtes Beispiel: Wie viele Werften, die Segelschiffe produziert haben, haben die Einführung des Dampfschiffs überlebt? Keine! Als diese neue Technologie aufkam, hatten sie 100 Jahre Zeit, alle haben gesehen, dass sich etwas verändert. Doch Werften – und viele Kunden auch – haben nur Argumente dagegen gefunden. Die Segelschiffhersteller waren nicht in der Lage, die disruptive Technologie anzunehmen. Als dann alle umgestellt haben, war es zu spät. Disruptive Energie, die einen bedroht, muss man scannen und bewerten. Von den Kunden erfährt man nicht, was das nächste große Ding ist – und wenn doch, ist es zu spät!