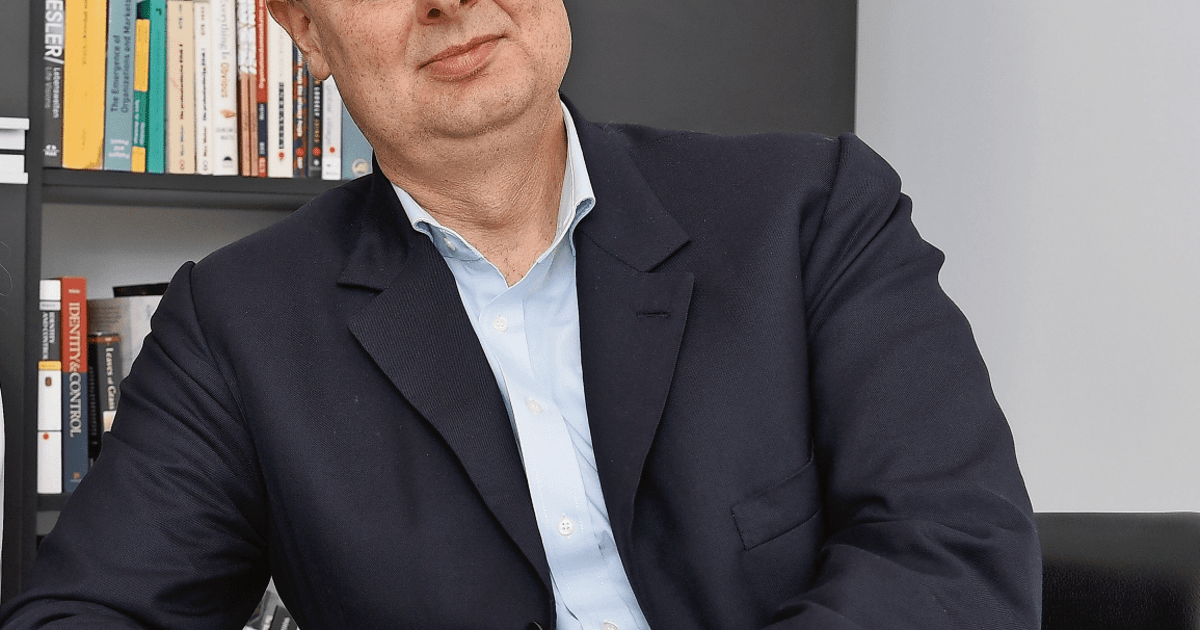
INTERVIEW STEPHAN STRZYZOWSKI
Jemand hat mir einmal das Buch „Team of Teams“ von General McChrystal empfohlen. Dieser General war im Irak. Er beschreibt, wie die am besten ausgerüstete Armee der Welt 2004 von einem Netzwerk aus Leuten in Ledersandalen mit alten Kalaschnikows völlig outperformt worden ist. Das war eine narzisstische Kränkung für die USA. Die Amerikaner hatten War-Rooms, wo man in Echtzeit jedes Detail der Truppen sah. Doch das hat nichts gebracht.
Warum nicht? Weil sie mit nichtlinearen Überraschungen konfrontiert wurden. Und in einem Umfeld, das von Überraschungen geprägt ist, funktionieren Zukunftspläne und Strategien nicht.
Was war sein Lösungsansatz? Er hat erkannt, dass man vor allem schneller werden muss. Es braucht ein gemeinsames Lagebild. Er nennt das „shared situational awareness“. Im Irak war er damit sehr erfolgreich. Sein Ansatz war: Wir müssen uns rascher gemeinsam über unterschiedliche Gruppen hinweg vernetzen. „Only a network can fight a network“, das ist das Motto. So können wir viel schneller lernen. Wir müssen „responsiveness“ erzeugen.
Und dieses Prinzip gilt auch für Unternehmen und für Wirtschaftsstandorte? Genau. Es geht um die Frage, wie wir spüren können, was abgeht, es zu verstehen und zu reagieren. Und wie man diesen Prozess schneller machen kann.
„Wir müssen endlich aufhören, in Branchengrenzen zu denken.“
Wie hat McChrystal das gemacht? Er hat Vertreter aller Streitkräfte vor Ort in einem Raum zusammengebracht. Das waren bis zu 2.000 Leute, die da teilgenommen haben. Das war wichtig, weil davor alle ihre eigenen Analysen und Bilder hatten: die Marines, die Navi, die CIA, die Airforce. Und dann ist auf einmal irgendwo eine Bombe hochgegangen, und es hat zwei Tage gedauert, um zu analysieren, was passiert ist. Die Aufstellung der USA war also davor fragmentiert, und man hatte kein gemeinsames Lagebild. Seine zentrale Erkenntnis: Wenn man in die Zukunft will und man nicht einmal weiß, von wo man weggeht, führt das zu schwerwiegenden Konflikten.
Und was heißt das für unseren Wirtschaftsstandort? Dass wir eine Dekade eines neuen Wir brauchen. Wir sind auch so fragmentiert. So zersplittert. Wie kommen wir zu dem gemeinsamen Lagebild? Wie kommen wir zu adaptierten Strategien? Wo stehen wir? Wo sind wir stark? Wie werden wir schneller darin, gemeinsam Situationen einzuschätzen? Was ist bei unseren Weltmarktführern los, auf den FHs, in den Spitälern? Denn es ist ja ein gemeinsames Ökosystem. Von Start-ups bis zu den Etablierten, bis zu denen, die gerade disruptiert werden, bis zu den Vordenkern. Sie müssen alle Teil einer gelingenden Innovationsökologie sein.
Müssen die auch alle in einen Raum, bevor die nächste wirtschaftliche Bombe hochgeht? Meiner Ansicht nach, ja! Es braucht auch in der Wirtschaft solche Situation-Rooms, die man rasch etablieren muss. Es geht um Multistakeholderforen, die man moderieren muss. Wir sollten die Leute identifizieren und dann schauen, wie sich das Lagebild gestaltet und wer was tun muss.
Die Baustellen des Wirtschaftsstandorts sind doch sattsam bekannt: Bildung, Innovation, Fachkräfte, Kapital, Steuern. Liegen diese Informationen nicht bereits klar auf dem Tisch? Natürlich, aber sie bringen uns nicht weiter, weil die Informationen nur wirksam werden können, wenn man weiß, wie die Aktionen ineinandergreifen. Das bleibt bei uns fragmentiert. Solange es so ist, kommen wir nicht zu einem gemeinsamen Lagebild. Und es gibt noch einen Aspekt: McChrystal hat Leute über alle Ränge hinweg zusammengebracht. Denn nur so lässt sich Verantwortung an die Peripherie verlagern. Das wäre dringend nötig, denn die Menschen vor Ort wissen mehr. Das geht aber nur, wenn es im Zentrum ein Lagebild gibt.
Sehen Sie diese Aufgabe bei der Politik? Es gibt natürlich die Ministerien, aber das ist wieder fragmentiert. Und die Ministerratssitzung bringt es auch nicht. Es braucht Orte, wo man über Grenzen hinweg die Lernzyklen verbessern kann.
„In einem Umfeld, das von Überraschungen geprägt ist, funktionieren Zukunftspläne und Strategien nicht.“
Die globale Situation scheint komplexer zu werden, und die Notwendigkeit, rasch zu reagieren, steigt: wirtschaftlich, aber auch politisch. Standortentscheidungen sind allerdings meistens recht langfristige Investitionen und Vorhaben. Wie geht man damit um? Da gibt’s eine Regel. Bei „shared situational awareness“-Meetings ist es entscheidend, dass die Gruppe unterscheidet: Welche Probleme haben wir, die wir lösen können? Und welche sind kompliziert? Für die gibt es eine Lösung, aber wir brauchen Spezialisten. Und dann gibt’s komplexe Probleme, wo wir die Lösung nicht kennen, aber zuversichtlich sind, dass wir sie lösen können. Da braucht es Netzwerke und neue Ansätze. Und dann – und das ist neu – gibt es Probleme, für die es keine Lösung geben wird! Man kann sich nur annähern, damit müssen wir uns abfinden.
Haben Sie ein Beispiel? Die neue Rolle Chinas. Das können wir nicht lösen. Das muss man akzeptieren. Man muss unterscheiden lernen. Es wird also nicht wirklich alles komplizierter. Man muss das monströse Knäuel nur zerpflücken. Mir sind keine Systeme bekannt, die man nicht mit sieben Variablen erklären kann. Doch das Timing ist manchmal unabsehbar. Man weiß nie, wann sich die Raupe transformiert. Man weiß nie, wann der Stress überhandnimmt. Deshalb müssen wir als Gruppe die Fähigkeit entwickeln, die Anzeichen zu lesen. Wie die Feuerwehr. Wenn sie sich ins Unbekannte bewegt, kalkuliert sie fix ein, dass es Überraschungen geben wird. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir immer öfter nicht alles wissen.
Vielfach sind Standortfragen nationale Agenden. Lassen sich in einer globalisierten Wirtschaft Maßnahmen überhaupt noch sinnvoll regional umsetzen, oder ist das ein Denkfehler? Wir müssen sicher über unsere Grenzen hinaus denken und schauen, wer welche Flanke abdeckt. Man bewegt sich gemeinsam vor und passt auf Schwächen auf, setzt auf Arbeitsteilung. Deswegen wird Diversität immer wichtiger. Man braucht heute eine Werkzeugtruhe mit vielen Tools, und man nimmt, was man braucht. Der Standort, von dem wir sprechen, muss sich dessen bewusst sein und es dann angehen. Wir müssen zusammenrücken.
Tun wir das nicht? Nein, gerade nicht. Es dämmert aber, dass wir so nicht weiterkommen. Dass nur ein paar Personen bestimmen, wo es langgeht, und der Rest erfährt es aus der Zeitung oder von Twitter. China und künstliche Intelligenz, aber auch der Klimawandel: Das sind so große Brocken, von denen niemand weiß, was die Entwicklung bedeutet. Auch nicht in den Netzwerken, die es richten sollten. Darum brauchen wir auch neue Allianzen und Schulterschlüsse. Wir müssen endlich aufhören, in Branchengrenzen zu denken. Es gibt heute Wertschöpfungsökologien, die alle Grenzen sprengen. Alle müssen jetzt ihre Kasteln aufbrechen.
Wo sehen Sie dahingehend in Österreich Chancen? Es gibt hier schon einen Pragmatismus, wo man dann zusammenarbeitet. Wir sind zwar sicher keine First Mover, aber Implementierungsweltmeister. Wir müssen Generalisten sein. Allein aufgrund des Risikos. Wir sind sehr divers mit unseren Branchen aufgestellt. Das ist definitiv eine Stärke. Vorarlberger sind anders als Oberösterreicher oder Burgendländer. Darin liegt eine kulturelle Stärke. Darum sind wir ja auch ein super Testmarkt, weil wir so große Unterschiede auf so kleinem Raum haben.
Welche Rolle soll und kann Europa und damit auch Österreich in einer globalen Ökonomie einnehmen? Wir sollten der Pionier sein, der vorangeht und Türen in die Zukunft öffnet. Wenn wir nicht eine ökosoziale Marktwirtschaft etablieren, gehen wir mit dem chinesischen System unter. Dort entsteht gerade ein digitaler Autoritarismus. Wer nicht brav ist, bekommt kein Flugticket, dessen Kinder bekommen keinen Schulplatz. Das ist eine irre soziale Kontrolle. Wir haben dafür gekämpft, so etwas loszuwerden.
Wo wird diese Richtungsentscheidung Ihrer Ansicht nach fallen? In den großen Ballungsräumen. Der Physiker Geoffrey West hat aufgezeigt, dass in einer Stadt, die doppelt so groß ist, man nicht nur doppelt so viele Patente hat, sondern viermal so viele. Durch diese Verdichtung wird allerdings die Peripherie abgehängt. Auch gesellschaftlich.
Wie wirkt sich das aus? In einer Kluft zwischen jenen, die im Innovationsgame mitspielen, und jenen, die keine Chance mehr haben. Der Verlust einer Selbstwirksamkeitserfahrung in einer Welt, die immer mehr Leute aus der Wettbewerbsfähigkeit ausschließt, ist brandgefährlich. Wir müssen auf diese Zentralisierungen aufpassen. Denn sie werden ärger. Immer weniger Player bekommen immer mehr Geld. Wie im Fußball, wo wenige Clubs immer mehr Geld und bessere Spieler bekommen.
Und was heißt das für unseren Standort? Das weiß niemand. Solange das Kapital im Flow ist, solange investiert wird, ist die Ungleichheit kein so großes Problem, aber wenn sich das so richtig akkumuliert, gibt es ein Riesenproblem.
