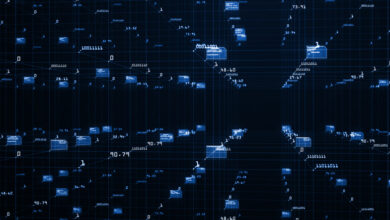Was Kunden wirklich wollen
Unternehmen würden am liebsten in die Köpfe ihrer Kunden hineinschauen, um deren geheimste Wünsche kennenzulernen. Doch wer zu viel über Kunden weiß, macht es sich oft sogar schwerer.

Seit es das Internet mit den sozialen Medien, Onlineshops und Foren gibt, scheint es ein Kinderspiel zu sein, alles über Kunden und Zielgruppen herauszufinden, denn sie hinterlassen mächtige Datenspuren. Beinahe alle ihre digitalen Schritte lassen sich tracken, jeder Klick und jedes Like, jede Verweildauer und jeder Kauf. Wer alles über seine Zielgruppen weiß, hat es leicht, Produkte für sie zu entwerfen, ihnen den besten Service anzubieten und ihre sehnlichsten Wünsche zu erfüllen – nicht wahr? Ganz so leicht ist es leider nicht. Oft erschwert es die Sache sogar, zu viele Daten über Kunden und jene, die es werden sollen, zu haben. Je mehr Daten es gibt, umso schwieriger ist zu beurteilen, welche wirklich aussagekräftig sind und wie sie zu gewichten sind. Auch lassen sich mit wachsenden Datenmengen nicht mehr so leicht Ziel- bzw. Fokusgruppen definieren, denn die Analysen zeigen, dass die Bedürfnisse der Menschen immer individueller werden.
Aber wie lernen Unternehmen ihre Kunden am besten kennen? Sollen sie ihnen Fragen stellen wie: Was würden Sie sich von unseren Produkten wünschen? Oder: Wie viel wären Sie bereit, dafür auszugeben? Sollen sie die Kunden in der Hoffnung, auf ihre wahren Wünsche zu stoßen, frei plaudern lassen über ein Thema rund um das Produkt? Ist es am besten, die Zielgruppe zu beobachten – beim Einkaufen, Lesen oder Surfen im Internet? Oder soll man sie Produkte am besten ausprobieren lassen? Die Motivforscherin Helene Karmasin von Karmasin Behavioural Insights sagt: „Es gibt ein unglaubliches Spektrum an Methoden in der Markt- und Motivforschung – von einfachen bis zu anspruchsvollen, die so weit gehen können, dass man die Gehirnaktivität der Kunden beobachtet.“ Die Methodenwahl richtet sich danach, was genau man herausfinden will: Geht es etwa darum, Verhaltensweisen zu eruieren, oder um die Gründe, warum Menschen etwas tun? Dass Unternehmen Kunden ins Zentrum stellen müssen, steht für Karmasin außer Zweifel: „Man muss alles, was am Markt geschieht, vom Kunden her denken, denn es herrscht ein Hyperwettbewerb. Dabei werden die Kunden nicht nur individueller, sondern auch immer anspruchsvoller.“
Es gibt drei wichtige Motive für Kunden, die laut Helene Karmasin immer gelten: Kunden wollen es einfach haben – Stichwort Convenience; sie wollen das Gefühl haben, dass ein Produkt genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist; und sie möchten einen guten Deal machen.
Die Leute lügen wie gedruckt über ihre Motive.

Darüber hinaus wird es aber schon schwierig, denn: „Die Leute lügen wie gedruckt über ihre Motive.“ Und auch im Prognostizieren ihres Verhaltens seien sie überfordert. Deshalb mache es oft keinen Sinn, Fragen zu stellen wie „Was muss das Unternehmen x tun, damit sie mehr von seinen Produkten kaufen?“ Auch, wenn man fragt, wie viel Geld sie für ein bestimmtes neues Produkt ausgeben würden, sind die Antworten nicht zuverlässig: „Sie wissen gar nicht, wie viel sie zahlen würden.“ Ebenso schwierig sei es, danach zu fragen, warum sie etwas tun: „Warum essen Sie Snacks?“ Oder: „Warum würden Sie ein E-Auto kaufen?“ Die Antwort würde vermutlich lauten: „Weil ich umweltbewusst bin.“ Die wahren Gründe, zum Beispiel, weil der Kollege auch ein E-Auto hat, verraten die Menschen in solchen Befragungen dagegen nicht.
Besser sei es darum, Menschen einfach erzählen zu lassen: „Jetzt sagen Sie mal, was haben Sie sich letzte Woche alles überlegt, als Sie das Essen eingekauft haben?“ Hier würden die Menschen dann nicht mehr sagen, dass sie nach gesunden Lebensmitteln gesucht haben, sondern eher Dinge wie: „Ich hab’ mich gefragt, was ich morgen koche und ob die Kinder das essen werden.“ Um ihren wahren Motiven auf die Schliche zu kommen, lässt Karmasins Institut die Menschen auch gern zeichnen oder Fotos machen. Als etwa eine Bergsportmarke mehr über die Kundenmotive erfahren wollte, ließ man die Befragten auf visuelle Art den tollsten Moment des letzten Bergurlaubs darstellen. Auch die Menschen zu bitten, ein Lebewesen zu zeichnen, das für sie eine bestimmte Marke repräsentiert und sie dann zu fragen, warum sie denn etwa eine Krake gezeichnet hätten, liefere nützliche und tiefgründige Ergebnisse.
Große Erfolge hat Karmasin immer wieder beim Beobachten der Menschen, während sie einkaufen. Dabei kann man sie bitten, „laut zu denken“. Höchst aufschlussreich sei es auch – etwa als Kosmetikmarke – die Menschen zu bitten, sie in ihren Kosmetikschrank zu Hause schauen zu lassen, oder – für ein pharmazeutisches Produkt – ins Arzneischränkchen. Und schließlich helfen Experimente, also etwa ein Supermarkt-Regal nachzubauen und zu schauen, nach welchen Produkten Kunden wirklich greifen.
Soziale Medien gehören selbstverständlich auch zur Kundenforschung dazu. Karmasin: „Was im Netz geschieht, sagt viel aus. Es gibt sehr raffinierte Modelle, die mithilfe von künstlicher Intelligenz analysieren, was die Leute interessiert.“ Doch so erfährt man erstmal nur, was die Menschen im Netz tun, aber noch nicht, warum sie es tun. Wonach sie wirklich suchen, wird hier auch noch nicht unbedingt sichtbar – und schon gar nicht, warum sie etwas – zum Beispiel das eigene Produkt oder Angebot – nicht gesucht haben.
Bei der Egger-Gruppe, einem weltweit tätigen Produzenten von Holzwerkstoffen mit 10.400 Mitarbeitern, setzt man in Sachen Kundenforschung auf mehrere Pferde. Direkte Kunden des Komplettanbieters für Möbel und Innenausbau, Fußböden sowie konstruktiven Holzbau sind die Möbelindustrie, der Holzhandel sowie Baumärkte. Indirekte Kunden sind Handwerksbetriebe, Architekten und Designer, und letztlich landen die Produkte beim Endkonsumenten. Ein Teil des Wissens über Kundenbedürfnisse kommt aus dem Vertrieb: Rund 220 Außendienst-Mitarbeiter pflegen laufend Berichte über ihre Kundenkontakte in ein Customer-Relationship- Management-System (CRM) ein. Ulrich Bühler, Egger-Gruppenleiter für Vertrieb und Marketing, sagt: „Wir bekommen jeden Tag mindestens 200 Berichte über Kundenbesuche – das ist die kontinuierlichste Marktforschung für uns, die es gibt.“ Hinzu kommen im Dreijahres-Rhythmus internationale Kundenzufriedenheits-Analysen. Innovationen werden meist in einem frühen Entwicklungsstadium von einer kleinen Kundengruppe „auf Herz und Nieren“ getestet. Werden neue Zielgruppen erschlossen, funktioniert das laut Bühler dann gut, wenn möglichst früh eine Gesprächsebene zu diesen aufgebaut wurde.
In den Sozialen Medien erfahren wir, was die Anwender interessiert.

Das Internet ist auch für Egger eine wichtige Quelle, um den Kundenbedürfnissen auf die Spur zu kommen. Bühler: „Soziale Medien sind für Unternehmen wie Egger der Kontakt zu den Endkonsumenten, also den Anwendern. Hier erfahren wir, was sie interessiert und bewegt.“ So hat Egger seit 2017 einen eigenen Social-Media-Bereich, der sich um die diversen Kanäle kümmert. Gemessen wird hier unter anderem, wie viel Traffic die Inhalte der sozialen Medien auf die Egger-Website bringen. Laut Bühler wählen sich jedes Monat etwa 600.000 Besucher auf der Website ein, Tendenz steigend. Bis zu zehn Prozent davon kommen aus Social Media. Aktive Follower gibt es etwa 300.000, wobei Märkte wie Russland oder China in den sozialen Medien besonders aktiv sind.
Und da ist noch das Kundenportal „myEgger“, das auf der Website rot hinterlegt hervorleuchtet. Auch über diesen Kanal kommen wertvolle Kundeninformationen herein: Hier können sich Kunden registrieren und dann in Echtzeit ihren Bestell- sowie Lieferstatus, Verfügbarkeiten und Preise einsehen. Und jeder, also auch der Endkunde, kann hier Muster bestellen. Pro Monat werden so 700.000 bis 800.000 Muster angefordert. Das Kundenportal ist mit einem ERP-System verknüpft und alle Daten werden automatisch synchronisiert.
Apropos Daten: Davon hat Egger offenbar sehr viele. Das ist gut, um die Kundenbedürfnisse im Blick zu haben, macht es aber auch komplexer als früher. Bühler: „Wir haben heute den Besucher auf der Website, auf dem Kundenportal, die einzelne Bestellung und so weiter. Wir haben viel mehr Messpunkte über das Kundenverhalten und sehen, was geliked und geteilt wird.“ Je mehr und je unterschiedlichere Daten das Unternehmen sammelt, desto intensiver muss es sich mit diesen auseinandersetzen und idealerweise die richtigen Schlüsse ziehen. Bühler: „Insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir durch all die Informationen, die wir erhalten, nicht zu viel, sondern eher zu wenig wissen und eine noch bessere Analytik brauchen, um diese auszuwerten.“
Die Geschäftsidee des Gebäudeautomations-Anbieters Loxone entsprang dem eigenen Bedarf der Gründer Thomas Moser und Martin Öller – und es stellte sich heraus, dass sich dafür auch reichlich Kunden fanden. Moser und Öller wollten 2009 in ihre eigenen Häuser automatisierte Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort bringen, die leicht zu bedienen und zu programmieren war. Doch was am Markt angeboten wurde, war aus ihrer Sicht unpraktisch, kompliziert und vor allem teuer. So gründeten sie Loxone und boten fortan eine leistbare Lösung an, bei der mithilfe des Miniservers als zentrales Gehirn in Gebäuden alles von der Beschattung über das Heizen und die Beleuchtung bis hin zu Zutrittskontrollen und anderem automatisch gesteuert werden kann. Mittlerweile hat Loxone Niederlassungen in zwölf Ländern, darunter in China und den USA. Das selbst gesteckte Ziel: Weltmarktführer im Bereich intelligenter Automatisierungslösungen für jeden Anwendungsfall zu werden.
Auch Loxone verkauft die Produkte nicht direkt an die Endkunden, sondern hat vor allem IT-affine Elektriker als Partner, die die Technik bei den Endkunden installieren. Von diesen gelangt das Feedback zum einen über soziale Medien und Foren an Loxone, zum anderen über die Installationspartner, die über die Kundenbedürfnisse sehr genau Bescheid wissen, weil sie am nächsten an den End-Usern dran sind. Immer wieder lädt Loxone die Betreiber von Online-Plattformen, auf denen sich Interessierte über die Installationstechnik der Loxone-Produkte austauschen, für zwei Tage ein, um sich das Feedback dieser „Tested Communities“ zu holen. Das Ziel ist dabei, nicht nur den Endkunden das Leben zu vereinfachen, sondern auch den Technikern, welche die Loxone-Produkte installieren.
Außerdem sind für Loxone nach wie vor die eigenen Bedürfnisse und Erfahrungen wichtige Gradmesser, um die Produkte und die Produktpalette weiterzuentwickeln. So nutzen laut Geschäftsführer Rüdiger Keinberger alle 400 Mitarbeiter Loxone selbst: „Das Schöne ist, dass alle Mitarbeiter zu Hause mit unserer Technik Erfahrungen sammeln und sie am eigenen Leib erleben. Wir haben eine junge Truppe, die das Produkt wirklich lebt.“ Auch der Unternehmenssitz im oberösterreichischen Kollerschlag ist voll automatisiert – hier sammelt man zusammen Erfahrungen für die Kunden aus dem Gewerbebereich.
Loxone bietet interessierten Kunden auch an, die Technik auszuprobieren und im Showhome am Unternehmenssitz zu erleben. Aktuell interessiert sich etwa eine große Hotelkette dafür, die Technik in ihren Hotelzimmern zu automatisieren. Anstatt lang und breit zu erklären, was die Technik kann, entschloss man sich, ein Hotelzimmer mit Loxone-Technik auszustatten. Keindorfer: „Wir wollten uns nicht erst lang zum Plaudern treffen, sondern lieber zum Arbeiten. Also sind Martin Öller, Thomas Moser und unser deutscher Geschäftsführer Manuel Nader gleich mit Werkzeugkasten angerückt und haben innerhalb eines Tages eine Suite im Hotel umgebaut.“ Die Projektverantwortlichen sammeln jetzt Feedback von Hotelbesuchern, welches dann wieder zu Loxone gelangt, wodurch das Unternehmen das Angebot an die konkreten Bedürfnisse anpassen kann.
Michael Brandtner, Spezialist für strategische Marken- und Unternehmensfokussierung, glaubt, dass die meisten Unternehmen bereits ein sehr gutes Gespür für die Bedürfnisse ihrer Kunden haben. Doch das alleine ist keine Garantie für Erfolg am Markt. Brandtner: „Auf der operativen Ebene kann man gar nicht genug über die Kunden wissen und sollte extrem kundenorientiert sein. Aber auf der strategischen Ebene sollte man eher wettbewerbsorientiert sein.“ Warum? Brandtner: „Pepsi hat kein Kundenproblem, sondern das Problem, dass es im Schatten von Coca-Cola steht. Für Herausforderer ist es viel wichtiger, beim Kunden in der Kaufentscheidung die erste Wahl zu werden – und das lässt sich mit Kundenorientierung nicht erreichen.“ Aber es lässt sich erreichen, indem man die Wahrnehmung der Kunden über die eigene Marke verändert und „aus dem mentalen Schatten des Marktführers tritt“.
Wer also nicht Marktführer ist, hat laut Brandtner drei Möglichkeiten, in den Köpfen der Kunden zur ernsthaften Option zu werden: Entweder man setzt in der Marketingstrategie auf das positive Gegenteil des Marktführers. Brandtner nennt als Beispiel Mercedes und BMW: Mercedes stand als Marktführer für Sicherheit und Komfort. Anstatt aber in die Falle zu tappen, den Kunden noch sicherere und komfortablere Autos anzubieten, setzte man auf das positive Gegenteil: Fahrfreude. Die zweite Möglichkeit ist, eine neue Kategorie zu erfinden wie es zum Beispiel Dr. Best mit der ersten nachgebenden Zahnbürste gemacht hat, Ryanair als erste Diskont-Fluglinie oder Apple mit dem ersten Smartphone. All das waren Innovationen, die der Kunde nicht nur als Verbesserung, sondern als etwas Neues empfunden hat. Die dritte Möglichkeit ist laut Brandtner, in eine bisher unbesetzte Nische zu gehen, wie es Hidden Champions tun, um dort Weltmarktführer zu werden.
Man kann nie genug über den Kunden wissen.

All diese Beispiele zeigen, dass „man nie genug über den Kunden wissen kann, es aber auch nicht den großen Unterschied macht“, so Brandtner. Überhaupt würden die stärksten Ideen geboren, wenn man dem Kunden nicht etwas gibt, was er sich wünscht, sondern indem man ihm etwas wegnimmt: „Steve Jobs hat dem Handy die Tastatur weggenommen. James Dyson hat dem Staubsauger den Beutel weggenommen. Ikea hat den Kunden die Bedienung weggenommen, dann die Hauszustellung und schließlich mussten sie die Möbel auch noch selbst zusammenbauen.“ So habe Ikea obendrein das genaue Gegenteil von Tischlern und anderen Möbelhäusern gemacht, die objektiv gesehen viel kundenorientierter waren. Brandtner: „Die meisten Unternehmen denken: Wie kann ich dem Kunden mehr geben? Dadurch werden die Dinge aber komplizierter. Wenn ich dem Kunden etwas wegnehme, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten – und oft kommen dann sogar sehr viel kundenorientiertere Ideen heraus.“
Vielleicht ist es also gar nicht so schlecht, wenn der Kunde bis zu einem gewissen Grad ein Mythos bleibt. Denn wer sich immer genau an seinen Bedürfnissen orientiert, kommt wohl nie auf die absurden Ideen, die so aufsehenerregend neu sind, dass keinem Kunden jemals eingefallen wäre, dass er daran einmal Gefallen finden würde.
Der Kunde will nicht König sein
Roger Rankel, Experte für Kundengewinnung, hält wenig von klassischen Umfragen, wenn es darum geht, die wahren Bedürfnisse der Kunden kennenzulernen.
Wie viel – oder wenig – wissen Unternehmen wirklich über ihre Kunden? Die Unternehmen analysieren schon sehr viele Zahlen. Aber Analytics sind immer vergangenheitsorientiert: Die Zahlen erzählen nicht, wie es in der Zukunft sein wird. Man müsste vielmehr nach vorne arbeiten und sich fragen: Was ist das Nächste, was der Kunde sich wünscht?
Wie findet man das heraus? Es heißt, das iPhone wäre nie entstanden, hätte man die Kunden nach ihren Bedürfnissen gefragt. Klassische Umfragen bringen nicht viel. Man muss eine Intuition entwickeln und antizipieren, was der Kunde nützen würde. Bei Google gibt es Kreativräume, wo am Eingang steht „Wir denken nicht nach, sondern vor“. Dort ist man angehalten, nicht darüber nachzudenken, was war, sondern was sein kann. Sinnvoll ist es auch, neue Dinge in einer Referenzgruppe auszuprobieren. Man kann auch Dinge ausprobieren, die noch nicht entwickelt wurden – zum Beispiel mithilfe von Animationen und Avataren. Im Silicon Valley arbeiten alle zunächst mit Betaversionen.
Wer im Unternehmen sollte sich um Kundenforschung kümmern? Alle – bis hin zum Pförtner. Denn es kann sein, dass die Produktentwickler nicht mehr sehen, was Kunden wirklich wichtig ist oder sie stört. Aber der, der die Räume reinigt, hat noch einen unverstellten Blick. Deshalb gibt es Unternehmen, die für jede Idee 50 Euro zahlen – und manche davon werden auch umgesetzt.
Was verändert sich, wenn Unternehmen entscheiden, den Kunden ins Zentrum zu stellen? Früher hieß es, der Kunde ist König. Doch das ist gefährlich, denn der Kunde mag es lieber, wenn ihm auf Augenhöhe begegnet wird. Starbucks hat vor einigen Jahren nicht gesagt „Wir müssen den Kaffee noch mehr rösten“, sondern den wirklichen Kundenwunsch in den Mittelpunkt gestellt. Die Kunden haben sich mit ihren Laptops in den öffentlichen Raum gesetzt, wo es kostenloses WLAN gab. Also hat Starbucks kostenloses WLAN angeboten. Das war der Durchbruch. Oder bei Motel One zahlt man schon zu Beginn und spart sich am Ende das Auschecken. Wenn Unternehmen die wahren Bedürfnisse der Kunden verstehen, ist das großes Kino.