
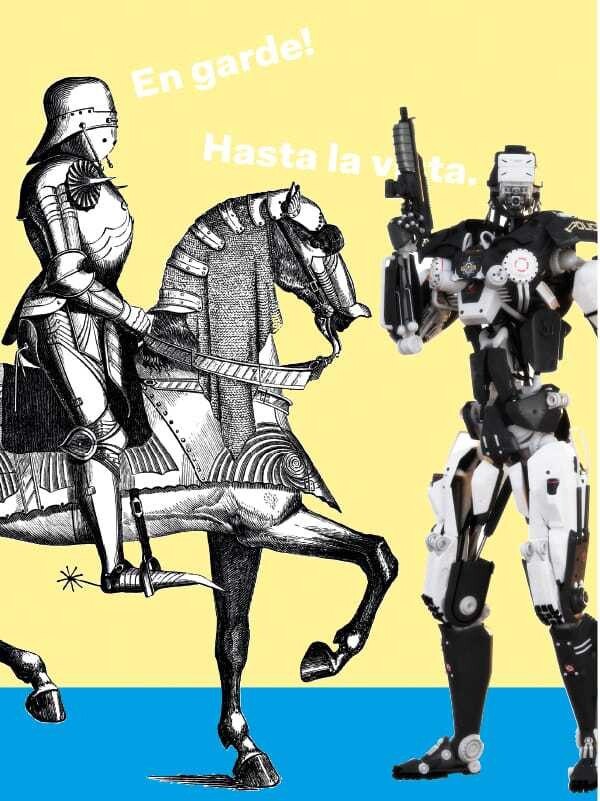
Das Internet wurde 1990 kommerzialisiert, die Einführung des iPhones ist noch keine zehn Jahre her, und Tablets haben sich seit 2010 verbreitet. Das sind nur ein paar Fakten, die verdeutlichen: Die Digitalisierung schreitet mit Riesenschritten voran. Sie zwingt alle Branchen dazu, ihre Produkte und Geschäftsmodelle in Frage zu stellen. Aber kann da jeder mit? Können sich KMU hohe Investitionen in die Digitalisierung überhaupt leisten? Und muss wirklich jeder dabei sein?
Karim Taga, Managing Partner Austria beim Unternehmensberater Arthur D. Little, glaubt, dass die Digitalisierung in nächster Zeit noch viele Opfer am Wegesrand zurücklassen wird: „Die Digitalisierung ist nichts anderes als eine Beschleunigung der Globalisierung. Und die Globalisierung wird immer von den kleinen Unternehmern fordern, effizienter zu werden und über Grenzen zu gehen.“ Angst vor den Entwicklungen dürfte keine Erfolgsstrategie sein. Gerade kleineren Unternehmen bietet sich die Chance, selbst groß zu werden, wie es etliche Start-ups vorgemacht haben. Die Globalisierung ist jetzt, wo die ganze Welt übers Internet miteinander verbunden ist, nicht mehr den Konzernen vorbehalten. Aber die neuen Möglichkeiten werden noch zu wenig genutzt. Arthur D. Little hat den digitalen Reifegrad von mehr als 100 europäischen Unternehmen untersucht und auf einer Skala von eins bis zehn bewertet, wobei zehn der höchstmögliche digitale Reifegrad ist. Der Durchschnittswert lag nur bei 3,92. Und: Nur 20 Prozent der Unternehmen verstünden es laut der Studie, „die Digitalisierung aktiv zu gestalten, während der Rest lediglich versucht, auf digitale Entwicklungen zu reagieren – ohne schlüssiges Gesamtkonzept“.
Verweigern geht nicht
Eine Branche, die schon lange mit der neuen digitalen Konkurrenz zu kämpfen hat, ist der Buchmarkt. Er zeigt auch, dass man besser mit den Entwicklungen geht, anstatt sich dagegenzustemmen. Jochen Jung, Leiter des kleinen österreichischen Literaturverlags Jung und Jung, war dem E-Book gegenüber zunächst skeptisch eingestellt. 2010 sagte er der Presse, er werde sich weiterhin „auf Papier verlassen“, und falls das E-Book doch einschlagen sollte, „kann man innerhalb eines Jahres nachziehen“. Heute sagt er: „Ich habe offensichtlich meine Meinung ziemlich rasch geändert.“
Der Markt und die Leser erwarten, Bücher auch in elektronischer Form lesen zu können, daher gibt Jung seit etwa fünf Jahren fast jedes Buch zusätzlich in elektronischer Form heraus. Die Autoren können selbst entscheiden – bisher habe sich noch niemand gegen das E-Book entschieden. Wirtschaftlich rechnen sich E-Books weniger: „Wir verdienen am gedruckten Buch mehr, weil die Vertreiber wie Amazon stark mitschneiden.“ Eine externe Firma kümmert sich darum, die elektronischen Bücher über mindestens zehn verschiedene Plattformen zu vertreiben. Maximal zehn Prozent des Umsatzes macht Jung, der rund 30 Titel im Jahr herausgibt, mit E-Books.
Auch Branchen wie Versicherungen können sich nicht mehr mit dem Argument der persönlichen Beratung aus der digitalen Affäre ziehen. Es wird erwartet, dass man, so wie man Musik, eine Pizza oder eine Flugreise im Netz kauft, auch eine Versicherung online abschließen kann. Daher hat die Kreditversicherung Prisma seit April Prisma Select im Angebot: Unternehmen, in erster Linie KMU, können sich damit online gegen Zahlungsausfälle versichern. Sie registrieren sich kostenlos und geben in eine Suchmaske Informationen über den Auftrag ein, den sie annehmen möchten, unter anderem Auftraggeber und -summe. Das System überprüft, wie wahrscheinlich es ist, dass der Auftrag bezahlt wird und legt gegebenenfalls ein Angebot für die Versicherung vor, die auch mit einem Klick abgeschlossen werden kann.
Ludwig Mertes, Markenvorstand der Prisma Kreditversicherung, sagt: „Als Kreditversicherer sind wir im Besitz einer riesigen weltweiten Datenbank mit Informationen über Unternehmen einschließlich ihres Zahlungsverhaltens.“ Man könne auf ein bewährtes Ratingmodell zurückgreifen. Auf dieser Basis trifft entweder das System oder ein Kreditprüfer die Entscheidung, „ob wir die beantragte Deckung übernehmen können oder nicht“. Die ersten fünf Prüfungen sind kostenlos, für jede weitere Anfrage fallen Prüfgebühren an. Wie beim Buch gilt hier: Zwar werden die digitalen Kanäle gut genutzt und weitere digitale Produkte folgen, aber „auch die traditionellen Vertriebswege werden bestehen bleiben, vor allem dort, wo intensive Beratung gebraucht
wird“.
Mut zu Investitionen
Natürlich ist es eine betriebswirtschaftlich wichtige Entscheidung, ob in neue digitale Produkte, Vertriebswege oder gar in die Produktionsumstellung auf Industrie 4.0 investiert wird. Gewagt hat das die Großwäscherei Wozabal. Sie baute mit Hilfe der IT-Firma Count IT eine digitalisierte und automatisierte Waschanlage.
Jedes Wäschestück ist durch einen eingebauten RFID-Chip identifizierbar. Bei der Anlieferung wird ausgelesen, um welche Wäsche von welchem Kunden es sich handelt. Das System weiß aufgrund der digitalisierten Aufträge, welches Stück wie gewaschen wird und was wann fertig sein muss. Die Anlage sortiert die Stücke, reicht sie durch Förderbänder zu den Wasch-, Bügel- und Sortierstationen weiter. Wenn Lkw-Fahrer die Wäsche aus der Anlage hinausfahren, erfasst das System wieder, was alles das Haus verlässt und druckt automatisch einen Lieferschein aus. Ein großer Vorteil: Es ist nie unklar, welche Wäsche gerade bei welchem Kunden ist. Außerdem erfasst das System, wie oft ein Stück gewaschen wurde und wann es ersetzt werden muss. Die Wäsche gehört Wozabal und wird von den Kunden wie Pensionistenheimen nur gemietet.
Peter Berner, Geschäftsführer von Count IT, sieht riesige Chancen und denkt etwa an Supermärkte, wo Kunden nicht mehr zur Kassa müssen, weil am Ausgang automatisch erfasst wird, was sie eingepackt haben. Überall, wo derzeit mit Barcodes gearbeitet werde, könne man auf Chips umstellen. Berner glaubt, dass die Digitalisierung nicht Arbeitsplätze kostet, sondern bringt: „Man braucht andere Jobs – und mehr Jobs.“ Es brauche nach wie vor Maschinenarbeiter, die Prozesse überprüfen und bei Problemen eingreifen. Durch die Digitalisierung könnten Unternehmen zudem mehr Aufträge bewältigen, ohne Personal zu reduzieren. Ansonsten würden „wir in Mitteleuropa alles verlieren, wo billige Arbeitskräfte benötigt werden. Entweder hat man die Chance zu digitalisieren, oder man verliert Kunden an Billiglohnländer.“ Zu den Investitionskosten sagt er: „Stellen Sie sich einen Händler vor, der keinen Webshop hat. Er muss 30.000 Euro investieren, das ist viel Geld. Aber was ist das im Verhältnis zur Alternative, gar keine Aufträge mehr zu haben?“
Effizienz und Kooperation
In eine ähnliche Richtung gehen die Entwicklungen im Bausektor. Dort etabliert sich weltweit die Methode „Building Information Modeling“ (BIM). Mithilfe von Software-Programmen werden alle wichtigen Gebäudedaten wie etwa Informationen zu Materialien digital erfasst, kombiniert und vernetzt und der Bau wird virtuell in 3D visualisiert. BIM hilft Auftraggebern, Planern und Baufirmen, besser zusammenzuarbeiten sowie Hausbetreibern beim Facility Management. Selbst Immobilienkäufer haben Vorteile: Sie können eine noch ungebaute Wohnung schon vorab virtuell sehen. Obwohl kürzlich in Österreich eine viel beachtete Norm herausgebracht wurde, die BIM-Standards festlegt, wird bei Bauprojekten im Inland meist noch ohne BIM gearbeitet. Wilhelm Reismann, Ziviltechniker der iC-Gruppe, kann das Zögern nachvollziehen: „Wir stehen vor einer neuen Arbeitsteilung zwischen Mensch, Maschine und IT. Vor solchen großen Schritten hat man immer Angst.“
Um dieser Angst Argumente entgegenzusetzen, die Digitalisierung in der Baubranche voranzutreiben und unter anderem BIM zu verbreiten, hat er im April mit mehreren Partnern die Initiative „Planen.Bauen.Betreiben 4.0 – Arbeit.Wirtschaft.Export“ ins Leben gerufen. Einmal im Jahr trifft man sich auf einer Enquete zum Austausch, und dazwischen stehen die Initiatoren Interessierten Rede und Antwort. Die Digitalisierung bringe auch mehr Effizienz, denn mit BIM ist es nicht mehr möglich, wie bisher während des Bauens noch umzuplanen. Jetzt werde zuerst „fix und fertig virtuell gebaut“, quasi „auf den Knopf gedrückt“, und dann erfolge das reale Bauen. Es werde auch in Österreich Pilotprojekte, etwa von der Asfinag oder der BIG, geben.
Das Beste aus zwei Welten
Ein Unternehmen, das auf den ersten Blick wie ein Digitalisierungs-Verweigerer wirkt, ist die Lomographic Society, ein in Wien ansässiger Kameraproduzent. Die kultigen „Lomos“ sind analoge Kameras, die oft mit einer verschwommenen, „retro“ wirkenden Ästhetik spielen. Doch ohne Digitalisierung wäre es gar nicht gegangen, erzählt Wolfgang Stranzinger, einer der Gründer: „Lomographie ist viel zu nischig, um die Firma nur in Österreich zu gründen. Man braucht eine gewisse Mindestmenge, damit sich das Investment rentiert.“ Bald nach der Gründung Anfang der 1990er Jahre wurden Lomo-Botschaften in verschiedenen Ländern gegründet – die erste in Berlin. Die Bewegung verbreitete sich schnell, und es kamen auch Bestellungen aus Hongkong und immer mehr Teilen der Welt: „Das haben wir allein dem Internet zu verdanken.“
Der erste Webshop funktionierte noch, indem die Kreditkartennummer per Mail geschickt wurde. Mitgründerin Sally Bibawy erzählt von der damals wachsenden Community: „Die Leute haben von ihren Wohnungen aus Kameras verkauft.“ Jedes Jahr werden neue analoge Foto- und sogar Filmkameras und Objektive entwickelt, riesige Ausstellungen auf großen Plätzen wie dem Times Square veranstaltet. 2015 wurde eine neue Lomography Community-Seite gelaunched, auf die schon über zwölf Millionen Fotos geladen wurden: Foto-Entwickler geben die Fotos meist auch in digitaler Form weiter – oder die Bilder werden eingescannt. Man produziert sogar Objektive für Digitalkameras – so lief gerade eine Crowdfunding-Aktion aus, bei der Geld für die Produktion eines Objektivs gesammelt wurde, das eine Art Neuauflage des ersten Objektivs der Geschichte ist.
Weniger glücklich lief es für Unternehmen, die den Schritt ins digitale Zeitalter zu wenig offensiv gewagt haben. Das Wirtschaftsblatt nannte etwa kürzlich die Taxler „das nächste Opfer der Digitalisierung“. Der aggressiv agierende Privatfahrten-Anbieter Uber erspart sich eine Taxizentrale, und das System kann Fahrten besser planen, sodass Standzeiten kürzer werden. Als Taxi-Konkurrenz kommen Car- und Fahrradsharing hinzu.
Unter Druck kommt auch die Hotelbranche durch Anbieter wie AirBnB. Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, sagt dazu: „Das Thema ist nicht so sehr, dass diese Privatvermieter uns ein Geschäft wegnehmen, sondern es geht darum, gleiche Spielregeln für alle zu schaffen.“ Schließlich müssen die privaten Anbieter nicht wie Hotels Steuern zahlen, und sie würden auch keine Arbeitsplätze schaffen.
Die Digitalisierung habe „eine unglaubliche Flexibilisierung“ gebracht, aber die Politik halte „an Maßnahmen fest, die 50 oder 60 Jahre alt sind“. So müssten etwa Arbeitszeiten flexibilisiert und die Gewerbeordnung vereinfacht werden. Reitterer: „Die Politik kann entscheiden, ob sie sich von der Digitalisierung treiben lässt oder selbst Maßnahmen setzt, um den Wirtschaftsstandort Österreich für die Zukunft zu öffnen.“ Vor allem wünscht sie sich, was viele Branchen derzeit angesichts der digitalen Zusatzangebote fordern: Gleiches Recht für alle.
